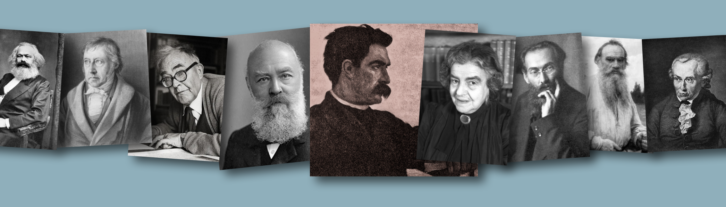Wenn wir heute von Sozialismus sprechen, ist die gedankliche Verbindung zum Christentum — abgesehen von der südamerikanischen Befreiungstheologie — wenn überhaupt, nur am Rande vorhanden. Allzu oft standen sie sich geradezu diametral gegenüber.
So erklärten sich die Anarchisten im Spanien der Zwischenkriegszeit als  radikale Kirchengegner, während die katholische Kirche Spaniens, die seit jeher die Interessen der Grossgrundbesitzer vertreten hatte, den Militärputsch des General Franco begrüsste und sich sofort als wichtiger Pfeiler in seine Diktatur einordnete.
radikale Kirchengegner, während die katholische Kirche Spaniens, die seit jeher die Interessen der Grossgrundbesitzer vertreten hatte, den Militärputsch des General Franco begrüsste und sich sofort als wichtiger Pfeiler in seine Diktatur einordnete.
Die französische Revolution, die im Wesentlichen soziale Ursachen hatte, zerstörte auf immer das enge Band zwischen Kirche und Staat in Frankreich. Und dass die Bolschewiki nach der Machtübernahme sofort einen rabiaten Feldzug gegen das orthodoxe Christenum in Russland in Gang setzten, ist bekannt.
Leonhard Ragaz glaubte den Grund dafür zu kennen:
Diese tragische Grundtatsache kann man so formulieren, dass in unserem festländischen Kulturkreis alle vorwärtsdrängenden Bewegungen, alle Bewegungen, die auf politische, soziale und kulturelle Weltveränderung, auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit abzielten, um mit Bedacht diese Losungen der französischen Revolution zu gebrauchen, alles Ringen um Recht, Wahrheit, Demokratie, bessere Gemeinschaft, sich gegen das offizielle Christentum wenden mussten, weil dieses, im grossen und ganzen gesehen, sich zuerst schon gegen sie gewendet hatte. Durch diese Tatsache ist der tragische Riss in unsere Gesellschaft gekommen, aus dem Verhängnis über Verhängnis quillt …
Die entscheidende Ursache für diesen Riss, der bis heute nicht verheilt ist, sah Ragaz im grossen Bauernkrieg 1525. Erinnern wir uns: Als Martin Luther seine Schrift “Von der Freiheit eines Christenmenschen” veröffentlichte, fand sie dank der Buchdruckerkunst innert kürzester Zeit eine gewaltige Verbreitung, — insbesondere bei jenen, für die “Freiheit” bis anhin ein Fremdwort gewesen war: den Bauern. Diese fanden zum ersten Mal religiöse Unterstützung und Ermächtigung für ihre  Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit an die Herren.
Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit an die Herren.
Damals waren Christus und das Volk eins. Die Bauern, die damals das nach seinem heiligen Recht begehrende Volk darstellten, sie trugen auf ihren Fahnen neben dem Bundschuh, dem Zeichen ihrer sozialen Forderung, das Bild des Gekreuzigten, als Sinnbild der religiösen Begründung dieser Forderung. Sie hatten in der Bibel, die ihnen Martin Luther in die Hand gegeben, das Evangelium von der freien Gotteskindschaft und der Bruderschaft der Kinder Gottes gelesen und zogen daraus mit gläubigem Enthusiasmus die notwendigsten und selbstverständlichen Folgerungen für das politische und soziale Leben.
Es lohnt sich, wieder einmal den Blick auf die berühmten Zwölf Artikel zu werfen, die von der oberschwäbischen  Eidgenossenschaft der Bauern aufgestellt wurden. Diese gelten zusammen mit der Bundesordnung als erste Menschenrechtserklärung der Welt. (Wikipedia)
Eidgenossenschaft der Bauern aufgestellt wurden. Diese gelten zusammen mit der Bundesordnung als erste Menschenrechtserklärung der Welt. (Wikipedia)
Damit kamen sie zu Martin Luther. Er war ihr geliebter Vertrauensmann. In seiner Hand ruhte damals, menschlich gesprochen, die Sache Christi für das Abendland. Nur wenige Male in der Geschichte hat ein Mensch die Waage der Weltgeschicke so in der Hand gehabt, wie dieser Mann in dieser Stunde. Wir wissen, wie es gegangen ist. Dieser Mann, dessen Grösse und Werk wir im übrigen nicht antasten wollen, er hat, zum Teil getrieben durch unselige Leidenschaft, zum Teil durch einseitig verzerrte Wahrheit, das Band zwischen Christus und dem Volke so furchtbar zerschnitten, dass es fast nicht mehr möglich scheint, es wieder zu knüpfen, und hat dafür die Sache Christi mit der Sache der Fürsten und Mächtigen so fest verbunden, dass es fast nicht mehr möglich scheint, diese Verbindung zu zerreissen.
Die gnadenlose Reaktion der Herren auf diese Forderungen sind ebenfalls bekannt:
 Ein breiter Strom des Blutes aus den Todeswunden von hunderttausend Bauern, in dem sich der Brand von tausend und tausend Dörfern und Städten spiegelte, aus dem die Schreie der gemarterten und geschändeten Kinder und Frauen ertönten, aus dem das Antlitz neuer, jahrhundertelanger Knechtschaft grinste, floss durch das christliche Abendland; — und dieser Strom trennt seither die Sache Christi von der Sache des Volkes. Vor diesem Strom stehen auch wir. (…)
Ein breiter Strom des Blutes aus den Todeswunden von hunderttausend Bauern, in dem sich der Brand von tausend und tausend Dörfern und Städten spiegelte, aus dem die Schreie der gemarterten und geschändeten Kinder und Frauen ertönten, aus dem das Antlitz neuer, jahrhundertelanger Knechtschaft grinste, floss durch das christliche Abendland; — und dieser Strom trennt seither die Sache Christi von der Sache des Volkes. Vor diesem Strom stehen auch wir. (…)
Die Tragik in unserer geschichtlichen Entwicklung besteht darin, dass in ihr zwei Linien auseinanderlaufen, die Linie derer, die an Gott glauben, aber nicht an sein Reich auf Erden, und die Linie derer, die an das Reich Gottes auf Erden glauben, aber nicht an Gott.
— und meinte damit natürlich den Marxismus als atheistische Heilslehre mit dem Ziel der klassenlosen Gesellschaft.
Leonhard Ragaz erkannte es als seinen Lebensauftrag, diese beiden Linien wieder zusammenzuführen.
Dazu mehr in der nächsten Folge am kommenden Samstag, den 8. April.
An anderen Serien interessiert?
Wilhelm Tell / Ignaz Troxler / Heiner Koechlin / Simone Weil / Gustav Meyrink / Narrengeschichten / Bede Griffiths / Graf Cagliostro /Salina Raurica / Die Weltwoche und Donald Trump / Die Weltwoche und der Klimawandel / Die Weltwoche und der liebe Gott /Lebendige Birs / Aus meiner Fotoküche / Die Schweiz in Europa /Die Reichsidee /Vogesen / Aus meiner Bücherkiste / Ralph Waldo Emerson / Fritz Brupbacher / A Basic Call to Consciousness / Leonhard Ragaz